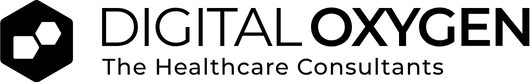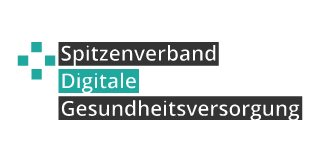„Müsli“ oder „Cornflakes“: Sprachbarrieren in der Versorgung
„NuqneH!“, liebe Leserinnen und Leser,
schön, dass Sie sich auch heute wieder Zeit nehmen für eine Reise in die unendlichen Weiten meiner Digital Health Notizen. Frei nach der „Sendung mit der Maus“ und für alle Nicht-Star-Trek-Fans: „‚NuqneH!‘ – das war ‚Guten Tag‘ auf Klingonisch.“
Um der Wahrheit die Ehre zu geben: „NuqneH“ ist nur der nächstbeste Ausdruck, der auf Klingonisch an „Guten Tag“ herankommt und bedeutet in der Sprache der kriegerisch-mürrischen Klingonen so etwas wie „Was willst Du?“.
Ja, bei Sprache kommt es schon ein wenig auf die Feinheiten an. Bevor Sie sich fragen, ob Sie sich in der Kolumne geirrt haben und weiterziehen, um die „Digital Health Notizen“ zu suchen, lassen Sie mich kurz ausholen: Star Trek hat mich schon in meiner Jugend fasziniert. Unter anderem, weil die Science-Fiction-Serie mindestens genauso großen Wert auf Science, also wissenschaftliche Akkuratesse, wie auf einfallsreiche Fiktion setzte. Und wo die Grenzen der Wissenschaft zum damaligen Zeitpunkt erreicht waren, führte man kurzerhand die Lösung einfach als gegeben ein. In der Realität steht dem berühmten Ort-zu-Ort-Transport („Beamen“) etwa physikalisch die Heisenbergsche Unschärferelation im Weg – deshalb gab es in jedem Transporter auch: Einen Heisenberg-Kompensator! Um die Versorgung auf den Raumschiffen sicherzustellen, gab es nicht etwa Frachträume voller Lebensmittel, sondern „Replikatoren“, die jedes Gericht aus einzelnen Molekülen zusammensetzen konnten. Und wenn die Crew auf eine fremde Spezies stieß, musste noch nicht einmal untertitelt werden, denn: An jeder Uniform befand sich ein „Universal Translator“, der simultan in und aus jeder Sprache übersetzen und neue Sprachen selbstständig erkennen und erlernen konnte. Schon in der frühen Science Fiction war den Machern bewusst, wie wichtig Sprache für jedes wie auch immer geartete Miteinander ist.
Zumindest hier wurde die Fiction inzwischen von der Science eingeholt: Googles „Translate“, Apples „Übersetzer“ und eine unüberschaubare Anzahl von Übersetzungsdiensten bieten inzwischen so etwas wie einen „Konversations-Modus“ an, mit dem man Alltagsgespräche halbwegs unfallfrei, wenn auch nicht perfekt, zweisprachig führen kann. Doch – und damit wären wir beim Thema – nicht immer genügt „halbwegs unfallfrei“, zum Beispiel bei Arztbesuchen oder in der Pflege. Bei einem Arztbesuch möchte das Praxisteam bestmöglich weiterhelfen können, Ärztinnen und Ärzte so gut wie möglich Anamnese und Beschwerden verstehen und die Patientinnen und Patienten diese so klar wie möglich artikulieren können. In zahlreichen Fällen ist das aber nicht problemlos möglich, sei es auf Grund von kognitiven Einschränkungen oder einfach, weil ein:e Patient:in nicht gut genug geschweige denn fließend Deutsch spricht. Laut „Business Insider“ sprechen mehr als 4 Millionen Menschen in Deutschland zu Hause gar kein Deutsch – die am häufigsten gesprochenen Sprachen sind in diesen Fällen Türkisch, Russisch, Arabisch, Polnisch und Englisch.
Während man in den meisten Praxen mit Englisch noch einigermaßen durchkommen sollte, muss man sich in den vielen anderen Fällen häufig anderweitig behelfen: Kinder oder andere Verwandte mit Deutschkenntnissen, manchmal auch Kolleg:innen, werden dann als Übersetzer eingespannt. Aus eigenen Gesprächen mit z. B. Diabetologen weiß ich: Das klappt dann „mal so, mal so“, denn wie gesagt: Es kommt auf die Nuancen an. Wenn es beispielsweise um ein passendes Frühstück geht, ist der Unterschied zwischen „Müsli“ und „Cornflakes“ für eine:n Diabetiker:in durchaus von Bedeutung.
Solche Sprachbarrieren sind in der Versorgungsrealität mehr als „interessante Anekdoten“, sie haben reale Auswirkungen: Auf der Seite der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration etwa wird ausgeführt, dass sich Menschen mangels Deutschkenntnissen z. B. eher an Notfallambulanzen wenden, obwohl sie zu einem Haus- oder Facharzt müssten. Und dass Sprachbarrieren mithin ernsten Folgen für ihre Gesundheit haben. Eine Studie im kanadischen Ottawa zeigte etwa, dass im Pflegebereich das Risiko für Nebenwirkungen oder Komplikationen bei Patient:innen mit mindestens zwei Vorerkrankungen um 74% geringer war, wenn sowohl die Patient:innen als auch die Pflegekräfte und Ärzt:innen dieselbe Sprache sprachen.
Und jetzt? Zunächst einmal: Das Problem ist bekannt und wird auch politisch unter dem Begriff der „Sprachmittlung in der Gesundheitsversorgung“ diskutiert. Die Herausforderung: Bei geschätzten 800.000 bis 1.000.000 nötigen Einsätzen pro Jahr für eine solche „Sprachmittlung“ muss auch jemand die Kosten übernehmen – und zumindest die GKV schließt jetzt und für die Zukunft die Übernahme solcher Kosten aus. Auf der anderen Seite besteht beispielsweise der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) darauf, dass solche Leistungen nur von offiziell zugelassenen Sprachmittlern erbracht werden können, am besten vor Ort. Das klingt – ganz offen gestanden – unbezahlbar, und vor allem noch viel weniger organisierbar. Wenn der BDÜ beispielsweise auf die Bedeutung von Gefühlen und kulturellen Besonderheiten hinweist, verstehe ich das. Wenn Video-Telefonie dann aber nur als Notlösung, die einen Vor-Ort-Einsatz nie ganz ersetzen kann, bezeichnet wird, ist mein Verständnis nicht mehr so wirklich vorhanden. Und wenn der BDÜ (zumindest noch im Mai 2023) kategorisch ausschließt, dass für die Sprachmittlung auf maschinelle Übersetzung zurückgegriffen werden könnte, wittere ich – verständlicherweise – nur noch Lobbygeruch. Denn dass Medizin-spezifische Sprachmodelle (LLMs, Large Language Models) für dieses Problem eine der hauptsächlichen und tragenden Lösungen sein werden, dürfte inzwischen wirklich außer Frage stehen – selbst wenn man Erschwernisse wie kulturelle Besonderheiten mit einbezieht.
Übrigens: Bei der schieren Menge solcher notwendiger „Sprachmittlungen“ dürfte sich auch kein einziger professioneller Sprachmittler Sorgen um die eigene berufliche Zukunft machen dürfen. Und bis es soweit ist? So lange gibt es natürlich bereits andere, ebenfalls funktionierende, aber eben oft analoge Hilfsmittel. Die Stadt München beispielsweise setzt zur Überwindung von Sprachbarrieren auf: Ausmalkarten. Not macht eben erfinderisch.
Bei uns gibt es jetzt Abendbrot – bei der aktuellen Jugendsprache durchaus auch ein Fall für einen Sprachmittler. Und wir sehen uns an dieser Stelle nach der Sommerpause wieder, wenn Sie mögen – bis dahin YItaD!
Anfrage senden
Ihr Ansprechpartner
Torsten Christann
Managing Partner