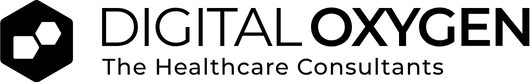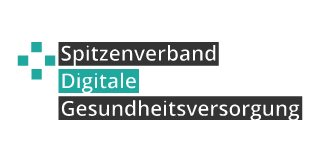Alter Wein in neuen Schläuchen?
Schön, dass Sie sich auch heute wieder zu mir gesellen, um mit mir durch meinen aktuellen „Digital Health Report“ zu blättern – Ihrer neuen Anlaufstelle für die aktuellsten Entwicklungen aus dem großen Bereich der „Digital Health“. Eigentlich genau wie vorher in meinen „Digital Health Notizen“, nur unter neuem Namen und dadurch eben: Besser.
Bevor sich bei den Stammleser:innen dieser Kolumne gleich tiefe und dauerhafte Verwerfungen auf der Stirn bilden: Nein, keine Angst, die „Digital Health Notizen“ bleiben natürlich die „Digital Health Notizen“. Mal ehrlich: Es wäre ja weder sinnvoll noch irgendwie glaubwürdig, dieselben Inhalte aus einer reinen PR-Motivation heraus einfach unter einem neuen Namen zu publizieren. Wobei ich es mir hier auch nicht zu einfach machen möchte: Grundsätzlich sind „Re-brands“ ja nicht pauschal nur nach Aufmerksamkeit heischende „Mogelpackungen“. Erst einmal ist ein neuer Name ganz einfach eine Veränderung – mit vielen möglichen Hintergründen und Motivationen. Aus dem Schokoriegel „Raider“ wurde hierzulande etwa „Twix“, um die Marke sukzessive international zu vereinheitlichen. Zumindest ein bisschen um’s gebeutelte Image dürfte es derweil bei der Umfirmierung der „Hamburg-Mannheimer“ zur „Ergo“ gegangen sein. „Super RTL“ heißt seit August diesen Jahres „RTL Super“, um Konsistenz mit anderen „RTL“-Präfix-Sendern zu gewährleisten – und warum das „Dänische Bettenlager“ seit einiger Zeit „JYSK“ heißt, wird zum einen für alle Zeiten ein ungelöstes Rätsel bleiben, ist zwar kürzer, aber auch nicht wirklich einprägsamer. Nike hieß einst Blue Ribbon, Google wurde zu Alphabet, der Facebook-Konzern wurde vor noch nicht allzu langer Zeit zu Meta, die Agentur für Arbeit war einst Das Arbeitsamt, und so weiter. Ebenso endlos wie die Reihe der Beispiele ist auch die Motivation: Vom Streben nach frischer Aufmerksamkeit, dem Ausdruck einer neuen inhaltlichen Ausrichtung, über die Kommunikation gemeinsamer Werte nach einer Fusion, bis zur Manifestation eines neuen Images.
Was also bedeutet es, wenn um 2025 herum – wie es in der Pressekommunikation des Bundesgesundheitsministeriums heißt – die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, in einer neuen Behörde aufgehen wird: dem „BIPAM“, dem „Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin“? Liest man die Pressetexte, geht es hier tatsächlich um mehr als den schönen Schein, um echtes „Nachholen“. Deutschland gebe „mehr für Gesundheit aus, als jedes andere EU Land“, sei aber „bei der Lebenserwartung trotzdem nur Durchschnitt“. Die unmissverständliche Botschaft: „Bei der Verhinderung von Krankheiten (…) haben wir Nachholbedarf.“ Der „Branding“-Schwenk der BZGA geht also von „Gesundheitlicher Aufklärung“ – also einem kommunikativen Fokus – mit dem BIPAM hin zum tatsächlichen Ergebnis, zur „Prävention“. So kritisch ich mit der Gesundheitspolitik oft ins Gericht zu gehen weiß: Das klingt erstmal gut. Ein Institut mit dem Fokus auf Prävention der größten Krankheitsgruppen, unter anderem also Krebs-, Demenz- und Herzkreislauf-Erkrankungen. Dass es ganz allgemein erstrebenswerter ist, von keiner dieser Erkrankungen betroffen zu werden, dürfte erst einmal unstrittig sein. Auch volkswirtschaftlich ist da wenig Raum zur Diskussion: Allein für 2021 taxiert die BAUA – die Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – den Ausfall an Bruttowertschöpfung durch Krankheitstage auf ca. 153 Mrd. Euro – etwas weniger als 5% der gesamten deutschen Bruttowertschöpfung 2021.
153 Mrd. € sind ein beachtlicher Schaden – und das ist nur der Wertschöpfungsausfall. Das BMG selbst gibt an, dass in Deutschland gut 5.000 € pro Person pro Jahr im Gesundheitssystem ausgegeben werden. Machen wir an dieser Stelle kurz Pause: Schnappen Sie sich Zettel und Stift, und schätzen Sie, wieviel die gesetzlichen Krankenversicherungen 2021 pro Person für Prävention ausgegeben haben.
Mal sehen, wie nah Sie dran sind: Laut GKV-Spitzenverband waren es insgesamt 537 Milliar- oh: Millionen Euro. Also 7,34 € pro versicherter Person. Spätestens beim Blick auf solche Zahlen dürfte klar sein, dass es mit einem „BIPAM“ allein wohl nicht getan sein wird – das wäre tatsächlich leider alter Wein in neuen Schläuchen. Wenn das lange vernachlässigte Thema Prävention nun wirklich ernsthaft angegangen werden soll, wenn wir wegen des Demographischen Wandels länger arbeiten sollen, bzw. wegen eines permanenten Fachkräftemangels auch müssen, dann braucht es nicht nur eine ambitionierte neue Behörde – dann müssen unter anderem auch die Krankenversicherungen fundamental umdenken. Ist es wirklich damit getan, einfach festzustellen, dass man zwar mehr pro versicherter Person für Prävention ausgibt, aber die Inanspruchnahme individueller Präventionsangebote 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist? Dass Krankenkassen im tiefsten Inneren noch nicht wirklich voll auf’s Präventionsgas drücken, mag historisch bedingt sein: Tatsächlich haben klassische Präventionsprogramme oft nicht den besten Ruf – und die meisten gesetzlichen Krankenkassen ein präventiv (pardon!) kritisches Verhältnis dazu. Doch allein die Verfügbarkeit und vollständig andere Natur nun verfügbarer digitaler Helfer – etwa in den Bereichen Mental Health oder Fitness – sollte (schon seit langem) Grund genug sein, diese Vorbehalte auf den Prüfstand zu stellen: Digitale Angebote sind so nah an den Patient:innen, und so individuell, wie es klassische Prävention – vom „Rezeptbuch“ bis zu „Bewegungsempfehlungen“ – schon von Natur aus nie werden sein können. Und für die Erhebung der nötigen Evidenz zu solchen digitalen Präventiv-Angeboten (sprich: „Wirkt Prävention?“) gäbe es zumindest schon einmal ein überaus erfolgreiches Vorbild: Die DiGAs. Auch wenn der Gedanke bei den Krankenkassen nicht zur Herz-Kreislauf-Stabilisierung beitragen wird: Wie wäre es mit einer Erweiterung des DiGA-Konzeptes auf – bisher explizit ausgenommene – digitale Präventions-Anwendungen: DiPrAs.
Als Branchen-Interessierte kann ich Sie, liebe Leser:innen und Lesser des PM-Reports, natürlich auch nicht einfach so „vom Haken lassen“: Prävention ist nämlich eine ebenso große Chance – und eigentlich auch ein wenig gesamtgesellschaftliche Verpflichtung – für Pharmaunternehmen. Ja, ich weiß: Dass sich eine Branche, die primär zur Therapie von Erkrankungen beiträgt und damit dann eben auch Geld verdient, übermäßig in der Prävention engagieren soll, ist erstmal – sagen wir „konterintuitiv“. Aber: Jetzt, da das Thema offenbar Aufmerksamkeit (und damit wahrscheinlich und hoffentlich eben auch wirtschaftliche Mittel) erhält, wird sich in jedem Fall jemand darum kümmern – warum also nicht auch die Pharmabranche?
Bevor bei mir jetzt allzu große Erschöpfung einsetzt, gehe ich schon einmal – präventiv – in den gemütlichen Teil meines Abends über. Und wir lesen uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder, wenn Sie mögen.
Anfrage senden
Ihr Ansprechpartner
Torsten Christann
Managing Partner