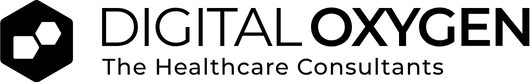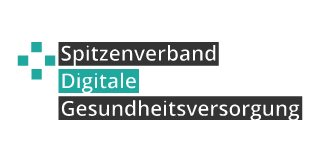Geschlechtergerechte Gesundheit rückt dank FemTech in den Fokus.
Jede:r von Ihnen hatte bestimmt schon einmal einen „Aha“-Moment: Eine Schleier-lüftende Eingebung und man begreift ein Thema, eine Frage, ein Problem, das man vorher entweder resigniert beiseitegelegt oder selbstsicher als „verstanden“ abgehakt hatte. Bei mir war Letzteres der Fall, aber gehen wir zunächst mal einen Schritt zurück.
In Deutschland wird bei rund 4.4% der Kinder und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren ADHS, eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, diagnostiziert. Dabei sehen wir drei verschiedene Ausprägungen: Hyperaktiv/impulsiv, unaufmerksam und kombiniert. So differenziert Diagnose und Kommunikation inzwischen auch sein mögen, hängt ADHS nach wie vor ein alter, prägnanter Beiname an: Das „Zappelphilipp-Syndrom“, das (überaus undifferenzierte und so oft schlicht falsche) Bild vom unzähmbaren Problemkind, immer wuselig und oft ein unkonzentrierter Störenfried. Und scheinbar ist der Zappelphilipp ja auch ein hervorragendes Bild, wenn wir uns die Geschlechterverteilung bei ADHS-Diagnosen ansehen: Jungen werden fast dreimal so häufig mit ADHS diagnostiziert wie Mädchen.
So gerne ich mich an dieser Stelle einer differenzierten Beleuchtung von ADHS widmen und auch hier einige verstaubte Ressentiment-Schubladen aufreißen möchte: Das ist heute nicht mein Thema, vielmehr: Die obige Statistik ist verzerrt, bei Mädchen ist ADHS nach aktuellem Kenntnisstand schlichtweg unterdiagnostiziert. Bei Jungen wird ADHS einfach häufiger erkannt, weil sie häufiger eine hyperaktive, gut beobachtbare Ausprägung zeigen als Mädchen. Somit sind Mädchen hier einfach aufgrund anderer Symptome als Jungs benachteiligt.
Dass es in der Medizin einen starken Gender-Bias, konkret eine unzureichende Berücksichtigung von Frauen in der Forschung, Aufklärung und Behandlung gibt, war und ist mir bewusst. Aber zum notwendigen Kontext hier ein kleiner Auszug: Bis 1993 waren hierzulande Frauen ganz selbstverständlich von medizinischen Studien ausgeschlossen, Dosierungen und Nebenwirkungen von Medikamenten basieren daher häufig primär auf Erkenntnissen mit männlichen Probanden und selbst heute noch fließen gerade einmal 4% aller Forschungs- und Entwicklungsgelder im Gesundheitswesen in die Gesundheit von Frauen – „Frauenthemen“ wie Menstruation oder ein unerfüllter Kinderwunsch werden praktisch nicht erforscht. Und das hat Folgen: Die typischen Symptome eines Herzinfarktes z. B. sind bei Frauen oft alles andere als „typisch“, Medikamente werden falsch dosiert, Fehldiagnosen werden gestellt. Bevor ich endlich zu meinem „Aha-Moment“ komme, eine letzte Offensichtlichkeit: Die Patientinnen-Gruppe, von der wir hier sprechen, macht mehr als 50% unserer Gesellschaft aus.
Frischen, digitalen Wind in diesen viel zu lange bestehenden Missstand verspricht nun ein neuer Begriff zu bringen: FemTech. Auch den hatte ich schon gehört, aber halbwegs unwissend als „verstanden“ abgeheftet: Unter dem jungen Begriff FemTech werden alle technologischen und mitunter digitalen Angebote für Frauengesundheit zusammengefasst. Und – bei all dem obigen Vorwissen – nun mein „Aha“-Moment: Femtech ist keineswegs nur eine kleine Nische. Wir sprechen nicht von dem ein oder anderen Beckenbodentrainer oder einer Zyklus-App. Wir sprechen von einem Wachstumsmarkt, der bis 2025 schon auf 25 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Wir sprechen von Technologie, die sich anschickt, die systematische Ungleichheit in der Frauengesundheit anzugehen, wir sprechen von riesigen Patient:innen-Gruppen, etwa von allein zwei Millionen Paaren in Deutschland, die ungewollt kinderlos bleiben. Wir sprechen von Innovationen, die schon lange das Leben vieler Frauen hätten verbessern können, hätte man ihnen Beachtung geschenkt: Ein smartes Armband für Linderung von Hitzewallungen, neue Scantechnologien, um das Risiko von Frühgeburten verlässlicher einschätzen zu können, und Tampons, die non-invasive Bluttests aus Menstruationsblut ermöglichen. Noch tun sich FemTech Start-Ups oft schwer mit der Finanzierung, nicht selten sicherlich auch, weil es im männlich dominierten Venture Capital oft nicht gelingt, die Potenziale solcher Vorhaben richtig einzuschätzen. Doch auch das wird sich ändern.
Nun wäre es schon ausreichend, die bestehende Ungleichbehandlung in der Medizin mit FemTech abmildern zu können. Der Fokus auf Frauengesundheit hat aber – nicht überraschend, wenn man ehrlich ist – auch ganz klare ökonomische Vorteile: Durch eine Geschlechterspezifische Medizin und dedizierte FemTech Produkte lassen sich die Gesundheitskosten insgesamt senken, vorhandene Gelder im Gesundheitssystem effizienter einsetzen und der Arbeitsmarkt entlasten: Wenn eine Gesellschaft beispielsweise über Fachkräftemangel klagt, läge doch nichts näher, als jede Chance zu nutzen, um 50% der arbeitenden Bevölkerung zielgenauer zu versorgen.
Für Pharma-Unternehmen bedeutet diese Entwicklung, dass sich nicht nur die Art und Weise, wie geforscht wird und Studien aufgesetzt werden, ändern muss, sondern das sich auch neue Wachstumspotentiale eröffnen, wenn frauengerechtere Produkte entwickelt oder mit FemTech-Unternehmen Partnerschaften geschlossen werden.
Ich hoffe, ich konnte auch Ihnen, liebe Leser:innen und vor allem Lesern, einen kleinen „Aha“-Moment bescheren und einen kleinen Beitrag zur dringend nötigen Aufmerksamkeit für dieses Thema leisten.
Anfrage senden
Ihr Ansprechpartner
Torsten Christann
Managing Partner